57. Vorarlberger Seilbahntagung in GötzisWarum Entbürokratisierung für die Bergregionen entscheidend ist. Immer komplexere Verfahren und langwierige Genehmigungsprozesse stellen Bergregionen zunehmend vor Herausforderungen. Vorarlbergs Seilbahnen warnen davor, dass Entwicklung dadurch ins Stocken gerät und fordern klar strukturierte Abläufe und gebündelte Zuständigkeiten, damit gute Projekte schneller umgesetzt werden können. Es gehe dabei ausdrücklich nicht um eine Senkung von Schutzniveaus, sondern um nachvollziehbare und effiziente Prozesse, die Planungssicherheit schaffen. Langwierige und komplexe Genehmigungsverfahren sowie überlappende Zuständigkeiten erschweren derzeit viele Projekte im alpinen Raum, mit Folgen für die gesamte Region. „Dort, wo Seilbahnen investieren und modernisieren können, bleibt der Tourismus lebendig, Arbeitsplätze werden erhalten und die Wertschöpfung im Tal gesichert. Die hohen bürokratischen Aufwände gefährden hingegen genau diese Strukturen und damit die Zukunft ganzer Regionen“, sagt Andreas Gapp, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Seilbahnen, im Rahmen der 57. Vorarlberger Seilbahntagung in der Kulturbühne AMBACH Götzis. Viele Hürden entstehen laut Gapp nicht wegen inhaltlicher Bedenken, sondern durch die vielschichtigen bürokratischen Strukturen. „Entscheidend ist, Zuständigkeiten zu bündeln und Abläufe klarer und nachvollziehbarer zu gestalten. Nicht der Schutz bremst Projekte aus, sondern die unübersichtlichen Wege dorthin.“ Praxis zeigt: Lange Verfahren, kaum Mehrwert Wie stark sich bürokratische Verfahren je nach Land und Region unterscheiden, zeigt der Blick über Vorarlbergs Grenzen. Christian Weiler, Geschäftsführer des Skigebietsplaners Klenkhart & Partner, nennt dazu Beispiele aus seiner Praxis: „In Bayern etwa wird die Kollaudierung, also die behördliche Abnahme und Überprüfung einer fertiggestellten Anlage vor der Inbetriebnahme, von einem privaten Sachverständigen durchgeführt. In Österreich braucht es für das exakt gleiche Ergebnis eine Vielzahl an Gutachten und Behördenwegen, was das Ganze ungleich unübersichtlicher und intransparenter macht.“ Auch bei großen Projekten führen lange Verfahrenswege nicht automatisch zu einem qualitativeren Output. „Wie schon Dr. Heinrich Klier treffend sagte: Früher haben wir drei Monate geplant und drei Jahre gebaut. Heute ist es genau umgekehrt“, betont Weiler. Trotz des massiv höheren Planungsaufwandes sei die Ausführungsqualit.t dadurch aber nicht im gleichen Maße gestiegen, da sich diese ohnehin seit Jahrzehnten auf einem sehr hohen Niveau bewegt, betont der Planungsexperte. In diesem Zusammenhang erinnert Weiler auch an die 20-jährige Planungsphase der Piz-Val-Gronda-Bahn in Ischgl: „Das Projekt wurde nach jahrzehntelangen Diskussionen und Behördenverfahren genau in seiner ursprünglichen Form umgesetzt und ist mittlerweile wertvoller Bestandteil des Gesamtskigebiets. Die lange Verzögerung hat nichts verbessert, sondern ausschließlich Entwicklungen ausgebremst.“ Schutz ja – Stillstand nein Die Seilbahnen stellen klar, dass hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards außer Frage stehen. „Schutz bleibt selbstverständlich ein zentraler Wert“, sagt Andreas Gapp. „Aber wenn Projekte über Jahre blockiert werden, obwohl sie auf höchstem technischen und ökologischen Niveau geplant sind, führt das zu Stillstand statt zu Fortschritt. Und das ist für alle Beteiligten eine Lose-Lose-Situation.“ Christian Weiler erklärt, dass viele hochwertige Biotopflächen in Skigebieten das Ergebnis von Pistenbaumaßnahmen seien, die nach höchsten Umweltstandards umgesetzt und über Jahre hinweg mit erheblichem personellem und finanziellem Aufwand erhalten werden. „So etwa werden Rasenziegel händisch verpflanzt, Flächen mit örtlich gewonnenem Mähgut rekultiviert und die Pistenflächen ökologisch nachhaltig betreut“, führt Weiler weiter aus. „Trotzdem werden diese Bemühungen in späteren Naturschutzverfahren nicht berücksichtigt. Hinzu kommt, dass Behörden immer häufiger Ausführungsplanungen verlangen, obwohl es eigentlich um Genehmigungsplanungen geht – das verlängert und verteuert Verfahren unnötig.“ Entbürokratisierung als Auftrag, nicht als Kritik Für die Fachgruppe ist klar: Entbürokratisierung bedeutet mehr Effizienz bei gleichbleibend hoher Kontrolle. „Es geht nicht darum, Schutzniveaus zu senken oder die Verwaltung schlechtzureden, sondern darum, beides zu stärken, damit gute Projekte schneller Realität werden können“, sagt Michael Tagwerker, Geschäftsführer der Fachgruppe Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Weiler sieht auch strukturelle Hebel: „Einheitliche und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, wie sie in Salzburg oder Bayern bereits bestehen, würden für deutlich mehr Klarheit und Transparenz sorgen. Dort kümmern sich etwa spezialisierte Arbeitsgruppen um Themen wie Wasserwirtschaft und Skianlagen, teilweise ergänzt durch die Einbindung privater Sachverständiger.“ Naturschutz und Effizienz sind kein Widerspruch Die Vorarlberger Seilbahnen investieren laufend in Qualität, sei es in Technologie, Pistenoptimierung, Service oder Umweltstandards, erklärt Gapp. „Wenn wir langfristig konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen wir unseren Gästen weiterhin höchste Standards bieten. Dafür brauchen wir verlässliche Prozesse und transparente Zuständigkeiten ebenso wie eine gesunde und intakte Natur.“ Ein verantwortungsvoller Umgang mit den alpinen Lebensräumen und effizientere Verfahren schließen einander nicht aus. Im Gegenteil: Beides ist notwendig, um Innovation, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Über die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg Die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg vertritt die Interessen von 68 Mitgliedern und 32 Skigebieten. Vorarlbergweit sind 246 Bahnen und Lifte in Betrieb, die insgesamt rund 1.000 Pistenkilometer bedienen. Factbox Seilbahnen Vorarlberg:
|
seilbahn.net | Themenbereiche | Wirtschaft | 2025-11-10
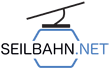


 Zurück
Zurück Fotos hinzufügen
Fotos hinzufügen Drucken
Drucken Email
Email